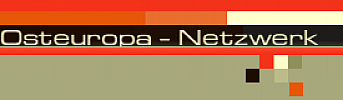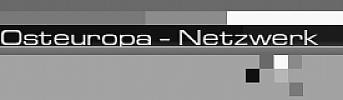Die Verfassung bringt in Art. 194 Abs. 1 mit der Festlegung des Grundsatzes der Wahl der Richter des Verfassungsgerichtshofes durch den Sejm die in vielen demokratischen Staaten vorhandene und von der Verfassungsrechtslehre allgemein gebilligte Überzeugung zum Ausdruck, dass diese Art der Wahl dem Gerichtshof die im Kontext seiner Kompetenzen außerordentlich wichtige demokratische Legitimation sichert. Somit ist die Regelung von Art. 194 Abs. 1 der Verfassung als eine Anknüpfung an den Grundsatz der repräsentativen Regierungsform (Art. 4 der Verfassung der Republik Polen) zu betrachten.
Die Wahl der Verfassungsrichter durch das Parlament kennzeichnen in Polen, wie in anderen demokratischen Staaten, eine starke Politisierung und Einwirkung der politischen Parteien, zumal ihrer Fraktionen, auf die Zusammensetzung des Verfassungsgerichts. Andererseits spricht für die Wahl, dass die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts die Gesetzgebung beeinflusst und deshalb der Gesetzgeber, als Ausgleich für diesen Einfluss, eine entscheidende Stimme bei der Auswahl der Mitglieder des Verfassungsgerichts haben sollte.
Die Verfassung legt in Art. 194 Abs. 1, der den Grundsatz der Wahl der Verfassungsrichter durch den Sejm für individuelle Amtszeiten regelt, keine Einzelheiten der Wahl der Verfassungsrichter fest.
- In seiner Sitzung am 8. und 9. Oktober 2015 wählte der Sejm fünf Richter des Verfassungsgerichtshofes in Anwendung von Art. 137 des Gesetzes über das Verfassungsgericht vom Juni 2015, der lautet: „im Falle der Verfassungsrichter, deren Amtszeit im Jahr 2015 abläuft, beträgt die Frist für die Einreichung des Antrags, von dem in Art. 19 Abs. 2 die Rede ist, 30 Tage ab Inkrafttreten des Gesetzes“. Das Verfassungsgerichtsgesetz vom 25. Juni 2015 trat am 30. August 2015 in Kraft. Die Wahl umfasste die Stellen der Richter, deren Amtszeit im November (3 Richter - 6. November 2015) und im Dezember 2015 (die Amtszeit eines Richters ging am 2. Dezember 2015, die eines weiteren am 8. Dezember 2015 zu Ende) auslief.
Der einzige Grund, der für die Einführung von Art. 137 in die Novelle des Verfassungsgerichtsgesetzes angegeben wurde, war der Wunsch, eine Situation zu verhindern, in der der am 25. Oktober 2015 neu gewählte Sejm nicht in der Lage wäre, rechtzeitig die neuen Richter zu wählen, und die Kontinuität der Amtszeit der Verfassungsrichter nicht gewahrt würde. Diese Kontinuität der Amtszeit ist jedoch weder ein Verfassungs-, noch ein Gesetzeswert, und in der Geschichte des VerfGH hat es mehrfach Fälle einer mehrmonatigen und sogar halbjährigen Vakanz einer Richterstelle gegeben, was das ordnungsgemäße Funktionieren des Gerichtshofes nicht gefährdet hat. Zudem führte der Gesetzgeber keine anderen dauerhaften Schutzmechanismen (Art. 137 des VerfGH-Gesetzes hatte lediglich einen einmaligen Charakter) gegen die Entstehung von Richtervakanzen im VerfGH ein.
Der Entwurf der Einführung von Art. 137 des VerGH-Gesetzes wurde gleich nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen eingebracht, als sich die Verteilung der Wählersympathien empirisch bestätigte, was auch eine Ankündigung für die kommenden Parlamentswahlen sein konnte. Außer Acht gelassen wurde außerdem ein weiterer Umstand: Am 17. Juli 2015 ordnete der Staatspräsident Parlamentswahlen für den 25. Oktober 2015 an. Dem Sejm der 7. Legislaturperiode war bei der Wahl der Verfassungsrichter am 8. September 2015 also bewusst, dass die Amtszeiten der Richter, die er wählt, erst nach den Parlamentswahlen und möglicherweise sogar auch nach dem Ende der Legislaturperiode des 7. Sejm ablaufen. Denn dieses Datum hing von dem Termin ab, für den der Staatspräsident die erste Sitzung des neu gewählten Sejm anberaumen würde.
- Die Erhöhung der Zahl der Richter durch die neue Verfassung (von 12 auf 15) machte die Wahl von drei neuen Richtern erforderlich. Im Hinblick auf die für den 21.09.1997 anberaumten Parlamentswahlen beschloss der Sejm der 2. Legislaturperiode (1993-1997), diese Mandate nicht zu besetzen und dies dem neu gewählten Sejm zu überlassen, obwohl seine Legislaturperiode formal erst nach Inkrafttreten der neuen Verfassung endete – am 20.10.1997 (einen Tag vor der ersten Sitzung des neu gewählten Sejm). Es entstand also ein dahingehender Präzedenzfall, die Wahl der Verfassungsrichter dem Sejm zu überlassen, der in allgemeinen Wahlen vor dem Beginn der Amtszeit der Verfassungsrichter ermittelt wurde, was der Verwirklichung des Grundsatzes der repräsentativen Regierungsform sowie der Gewährleistung der Meinungspluralität des Plenums des VerfGH diente. Die Richter wurden am 6.11.1997 gewählt. Für diese Lösung optierte damals Verfassungsgerichtspräsident Prof. Andrzej Zoll, der in einem Interview auf die Frage, ob der Sejm der 2. Legislaturperiode diese drei Richter wählen sollte, antwortete: „Ich stelle sein demokratisches Mandat nicht in Frage. Ich habe dieses Mandat mit meiner Unterschrift als Vorsitzender der Staatlichen Wahlkommission bestätigt. Aber ein Verfassungsgericht darf von Politikern nicht wie ‚ihres’ behandelt werden. Es darf nicht mit irgendeiner politischen Konstellation verbunden sein. Die neue Verfassung hat den Grundsatz eingeführt, dass die Amtszeit eines Richters neun Jahre beträgt. Dank diesem Umstand kann der Sejm mindestens dreier Legislaturperioden das Plenum des Gerichtshofs wählen. Würde dagegen der Sejm einer Legislaturperiode die Mehrheit der Richter wählen, hätte die herrschende politische Konstellation Einfluss auf den unabhängigen Gerichtshof“ [Interview von Robert Mazurek und Piotr Zręba mit Andrzej Zoll, „Życie“, August 1997; siehe auch eine Äußerung ähnlichen Inhalts in: Paweł Wronski, Bój o Trybunał (Der Kampf um den Verfassungsgerichtshof), „Gazeta Wyborcza“ 190/1997, S. 1].
- Die Verfasser des Gutachtens der Venedig-Kommission erklärten unter Bezugnahme auf diesen Präzedenzfall, einen für die Wahl von VerfGH-Richtern wesentlichen Brauch: „Was die Situation in Polen anbelangt, erscheint es verfrüht, auf der Grundlage eines einmaligen Ereignisses, das sich auch, als 2015 dazu Gelegenheit war, nicht wiederholte, von einem Verfassungsbrauch zu sprechen. Auf jeden Fall hat das zur Feststellung eines Verfassungsbrauchs befugte Organ, also der VerfGH, einen derartigen Brauch in seinem Urteil vom 3. Dezember 2015 nicht festgestellt. Tatsächlich hätte das Parlament, wenn die neue Mehrheit im Jahr 1997 den damaligen Präzedenzfall zum geltenden Prinzip hätte erheben wollen, dies in Form einer Änderung des VerfGH-Gesetzes beschließen können".
Dies ist insofern eine unzutreffende Ansicht, als sie die Rolle des Präzedenzfalls und des später darauf beruhenden Brauchs in der Praxis der Funktionsweise aller demokratischer Staaten - nicht nur der angelsächsischen, sondern auch in Kontinentaleuropa - verneint. Gewöhnlich ist es so, dass wenn etwas durch Präzedenzfall entschieden wurde, dies nicht mehr in rechtliche Lösungen eingeführt wird, weil die Angelegenheit als geregelt gilt. Gesetzliche oder verfassungsrechtliche Normen werden eingeführt, um einen Brauch zu ändern. Im polnischen Fall ist wichtig, dass der Präzedenzfall unmittelbar den Zeitraum des Inkrafttretens der Verfassung betraf, was von den Verfassern des Gutachtens nicht berücksichtigt wurde.
- Die Verfassung sieht in Art. 194 die Existenz individueller Amtszeiten der Verfassungsrichter vor. Gemäß Art. 21 des VerfGH-Gesetzes vom Juni 2015, der im Übrigen an die bis dato geltenden Lösungen anknüpft, begann diese – so wie die Amtszeit anderer vom Sejm oder der Nation gewählter Organe - nach der Eidesleistung, und sie dauert neun Jahre.
Art. 21 Abs. 1 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 über das Verfassungsgericht stellte fest, dass „eine in das Amt des Verfassungsrichters gewählte Person“ gegenüber dem Präsidenten seinen Eid ablegt. Hinsichtlich der Verwendung der Formulierung „eine in das Amt des Verfassungsrichters gewählte Person“ und nicht „Verfassungsrichter“ durch den Gesetzgeber stellen sich zwei Fragen: Ist ein Verfahren der Besetzung eines Richteramtes am VerfGH abgeschlossen, wenn an seinem Ende nicht die Vereidigung vor dem Präsidenten steht? Ist eine ins Verfassungsrichteramt gewählte Person ohne Ablegung des Eides bereits ein Verfassungsrichter?
Unter der Voraussetzung des sich aus dem Grundsatz des demokratischen Rechtsstaates (Art. 2 der Verfassung) ableitenden Grundsatzes der Rationalität des Handelns des Gesetzgebers ist anzunehmen, dass der Gesetzgeber bestimmte Formulierungen gezielt verwendet, um die von ihm gewollten Ergebnisse zu erzielen. Wenn er den Prozess der Richterwahl nach erfolgter Wahl durch den Sejm für beendet hielte, hätte er dies in der entsprechenden Norm für die Vereidigung zum Ausdruck gebracht. Als Beispiel dafür mag Art. 15 Abs. 1 des Gesetzes über die Oberste Kontrollkammer dienen, in dem es eindeutig heißt: „Vor Beginn der Ausübung seines Amtes legt der Präsident der Obersten Kontrollkammer einen Eid vor dem Sejm ab“. Der Gesetzgeber behandelt hier die vom Sejm gewählte Person bereits in der Zeit nach vollzogenem Wahlakt und vor der Eidesleistung als Amtsträger. Ähnlich ist es auch im Falle des Bürgerrechtsbeauftragten (Art. 5 des Gesetzes über den Beauftragten für Bürgerrechte).
Da der Gesetzgeber keine Formel verwendet hat, die die für das Verfassungsrichteramt gewählte Person eindeutig als VerfGH-Richter anerkennt, bedeutet dies, dass der Augeblick der Eidesleistung den Wahlprozess beenden soll.
Zweitens spricht dafür, dass das Besetzungsverfahren eines Verfassungsrichteramtes nicht vor Ableistung des Eides vor dem Staatspräsidenten beendet ist, auch der Umstand, dass die individuelle Amtszeit eines Verfassungsrichters ab dem Datum seiner Vereidigung und nicht dem Zeitpunkt seiner Wahl durch den Sejm gerechnet wird.
Drittens spricht dafür, dass das Besetzungsverfahren eines Verfassungsrichteramtes nicht vor Ableistung des Eides vor dem Staatspräsidenten beendet ist, auch die Möglichkeit, dass der Staatspräsident im Falle von Zweifeln an der Ordnungsgemäßheit der Wahl die Abnahme des Eides aufschiebt. Hier ist der verfassungsrechtliche Präzedenzfall zu nennen, der vor dem Hintergrund der Wahl von Frau Lidia Bagińska in das Richteramt durch den Sejm geschaffen wurde. Frau Bagińska wurde Ende Dezember 2006 vom Sejm zur Verfassungsrichterin gewählt. Ihre Vereidigung wurde aufgrund von Bedenken gegen ihre Tätigkeit als Insolvenzverwalterin aufgeschoben und fand am 6. März 2007 statt. Nach der Eidesleistung durch Richterin Bagińska kündigte der Verfassungsgerichtspräsident die Einberufung einer Generalversammlung der Richter des VerfGH an, die über ein eventuelles Disziplinarverfahren gegen Richterin Bagińska entscheiden sollte. Diese trat jedoch vorher – am 12. März - vom Amt des VerfGH-Richters zurück.
Keine Verfassungs- oder Gesetzesnorm regelt eine Überprüfung der Wahl von Verfassungsrichtern. Diese Überprüfung obliegt dem Sejm, wie im Übrigen der VerfGH in seinem Beschluss in der Sache U 8/15 anerkannt hat.
2015 teilte der Sejm der 8. Legislaturperiode die Bedenken des Präsidenten in Beschlüssen, mit denen die Wahl durch den Sejm der 7. Legislaturperiode für nichtig erklärt wurden, und dem Staatsoberhaupt blieb nichts anderes übrig, als sich nach seiner Entscheidung zu richten.
Erwähnenswert ist hier, dass ähnliche Praktiken, sogar mit noch weiterreichenden Folgen, in anderen demokratischen Staaten vorkommen. Eine Exemplifizierung ist die Weigerung des Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland (1963), den vom Richterwahlausschuss des Bundesgerichtshofes zum Bundesrichter gewählten Carl Creifelds zu ernennen. Bis zum Eintreten dieses Präzedenzfalls hatte man in der bundesrepublikanischen Rechtswissenschaft die Ernennung eines Bundesrichters durch den Präsidenten für eine bloße Formalität gehalten.
- Verfassungsrichter werden nach Art. 194 Satz 2 vom Sejm gewählt, und diese Kammer des Parlaments ist auch für die Besetzung aller Richtermandate verantwortlich. Der Präsident des VerfGH ist somit nicht befugt, den Status von Verfassungsrichtern zu bestimmen, insbesondere nicht darüber zu befinden, welcher Richter trotz Erfüllung aller im Recht vorgesehenen Voraussetzungen zur Ausübung des Mandats eines Verfassungsrichters zur Entscheidung zugelassen wird. In diesem Fall gibt es keine Rechtsgrundlage für die in der Praxis eingeführte Kategorie: „Richter, deren Status sich aus dem Urteil des Verfassungsgerichts vom 3. Dezember 2015 in der Rechtssache K 34/15 (G.Bl. Pos. 2129) ableiten“ [http://trybunal.gov.pl/o-trybunale/sedziowie-trybunalu/].
Das Urteil in der Rechtssache K 34/15 kann nicht als Grundlage dienen. In seinem Tenor ist vom Status der Richter überhaupt nicht die Rede. Es findet sich darin allein eine allgemeine Aussage über die Verfassungsmäßigkeit der Normen des Gesetzes vom 25.6.2015 in seinem ursprünglichen Wortlaut bezüglich der Verfassungsrichterwahl [„Art. 137 des in Punkt 1 zitierten Gesetzes:
a) steht im Einklang mit Art. 112 der Verfassung und steht nicht im Widerspruch zu Art. 62 Abs. 1 und Art. 197 der Verfassung,
b) soweit er sich auf die Verfassungsrichter bezieht, deren Amtszeit am 6. November 2015 abläuft, steht er im Einklang mit Art. 194 Abs. 1 der Verfassung,
c) soweit er sich auf die Verfassungsrichter bezieht, deren Amtszeit am 2. bzw. 8. Dezember 2015 abläuft, ist er nicht vereinbar mit Art. 194 Abs. 1 der Verfassung“].
- Keine der bekannten Auslegungsmethoden erlaubt es, aus dieser allgemeinen Feststellung Schlussfolgerungen bezüglich des Status der 2015 gewählten Verfassungsrichter abzuleiten. Am Rande ist auch erwähnenswert, dass der Verfassungsgerichtshof in seinem Urteil vom 3. Dezember 2015 weder im Tenor noch der Begründung die vom Sejm der 8. Legislaturperiode am 2. Dezember 2015 vorgenommene Wahl von 5 Personen in das Amt des Verfassungsrichters und ihre Eidesleistung vor dem Staatspräsidenten berücksichtigt hat. Nach dieser Wahl und der Vereidigung hat der VerfGH 15 Richter. Der Sejm dagegen befand die Wahl vom 8. Oktober 2015 für verfahrensrechtlich nicht korrekt. Ob Art. 137 des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof vom 25.6.2015 in seinem ursprünglichen Wortlaut verfassungskonform ist oder nicht, ist hier also ohne Belang, weil es nicht die Grundlage für die Beurteilung der am 8. Oktober 2015 vorgenommenen Wahl der Verfassungsrichter durch den Sejm der 8. Legislaturperiode bildete. Damit ist eine weitere Nichtzulassung von 3 der 15 VerfGH-Richter zur Entscheidung eine Verletzung von Art. 194 Abs. 1 und ausschlaggebend für die nicht ordnungsgemäße Besetzung des Spruchkörpers in Rechtssachen, die der VerfGH in voller Besetzung zu prüfen hat.
In der polnischen Verfassung, wie wohl in der Praxis jedes anderen Verfassungsgerichts, gibt es nicht den Status eines Mitarbeiters des Verfassungsgerichtshofes, der keine richterlichen Aufgaben erfüllt. Alle im Dezember 2015 gewählten Richter erhielten vom Präsidenten des VerfGH Richterdekrete, beziehen Richtergehälter und wurden bei der Sozialversicherungsanstalt als Verfassungsrichter gemeldet. Der Präsident des VerfGH hat nicht nur keine rechtliche Grundlage dafür, die Wahl der Verfassungsrichter in Frage zu stellen, sondern auch nicht, die Betrauung mit richterlichen Aufgaben zu verweigern. Ein derartiges Vorgehen, das die Befugnisse eines Organs der öffentlichen Gewalt ohne Rechtsgrundlage ausweitet, stellt eine eklatante Verletzung der Grundsätze eines demokratischen Rechtsstaates (Art. 2 der Verfassung der Republik Polen) und des Legalitätsprinzips (Art. 7 der Verfassung: „ Die Organe der öffentlichen Gewalt handeln auf der Grundlage und in den Grenzen des Rechtes.“) dar.
„Ein Organ der öffentlichen Gewalt, das sich an das Legalitätsprinzip hält, sollte von Amts wegen selbst seine Zuständigkeit (ergo - Kompetenz) zur Behandlung und Entscheidung einer anhängig gemachten oder übernommenen Rechtssache prüfen. [...] Die Verpflichtung, innerhalb der durch das Recht gesetzten Grenzen zu bleiben, gilt für alle Formen der Tätigkeit von Organen der öffentlichen Gewalt. [...] Normen, die die Verpflichtungen staatlicher Organe definieren, werden nicht nur auf der Grundlage von Vorschriften des materiellen Rechts, sondern auch Verfahrensvorschriften sowie das System der entsprechenden staatlichen Organe betreffenden Vorschriften rekonstruiert“[Urteil vom 20.9.2005., U 4/06, OTK A-2006, Nr. 8, Pos. 109].
Bogusław Banaszak, geb. am 03.02.1955. Prof. Banaszak ist ausgewiesener Spezialist für Verfassungs-, Parlaments-, Verwaltungsrecht und Menschenrechte. Er verfasste zahlreiche Gutachten für das polnische Parlament und verfügt über umfassende Erfahrung in Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen zu Entwürfen von Regierungsunterlagen, insbesondere zu Gesetzesentwürfen und Entwürfen der Voraussetzungen für Gesetzesentwürfe. 2001-2001 Mitglied des Beirates des Außenministers für Menschenrechte. Er war Berater des Beauftragten für Bürgerrechte und Vorsitzender des rechtlichen Beirates des Premierministers. Seit April 2016 Mitglied der Venedig-Kommission des Europarates. 2002-2006 Koordinator der Schule des deutschen und des polnischen Rechts (gemeinsame Initiative der Universität Wrocław und der Humboldt-Universität Berlin). Mitglied in zahlreichen Gesellschaften, u. a. Societas Iuris Publici Europaei und World Jurist Association. Hält Gastvorträge an Universitäten in Europa (Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Ukraine, Ungarn), USA, Brasilien, Chile, Ekuador und Mexico. Autor von über 300 wissenschaftlichen Werken. Ausgezeichnet mit u. a. mit dem Goldenen Verdienstkreuz der Republik Polen und dem Bundesverdienstkreuz.