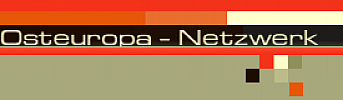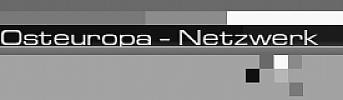Der Streit um das polnische Verfassungsgericht
- bewusste und absichtliche Desinformation – Vortrag in Berlin
Ich möchte die These verteidigen, dass die meisten Vorwürfe gegen die polnische Regierung unbegründet sind und auf einer bewussten und absichtlichen Desinformation der deutschen Öffentlichkeit basieren. Gemäß der polnischen Verfassung dürfen die Gerichte kein Recht schaffen, sondern es nur anwenden, das Verfassungstribunal dagegen soll entscheiden, ob Gesetze und andere Rechtsakte verfassungswidrig oder verfassungskonform sind (Art.4, 10 und 188). Das polnische Tribunal behauptet, dass es nur den Inhalt (wording) der Verfassung feststelle und sie in keinem Fall ändere oder korrigiere (so z.B. in der bekannten Entscheidung von 7.03.1995). Leider ist das reine Rhetorik, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Wir können ganz einfach beweisen, dass das Tribunal sowohl gänzlich neue Regeln setzt als auch geltende Bestimmungen mittels kreativer Auslegung modifiziert. Der ehemalige Präsident des Tribunals und Anhänger der „Bürgerplattform“ Prof. Lech Garlicki sagte einmal direkt: Wir haben in Polen zwei Verfassungen, eine 1997 vom Parlament verabschiedete und die andere, die durch die Rechtsprechung des Tribunals geschaffen wurde.
Lassen Sie uns die kreative Aktivität des Tribunals besehen. Meistens behauptet das Tribunal, die von ihm geschaffenen Regeln und Prinzipien folgten logisch aus der Rechtsstaatsklausel (Art.2 der polnischen Verfassung), was jedoch mehr als fragwürdig ist. Nehmen wir als Beispiel das berühmte Prinzip der legislativen Sorgfalt (legislative diligence), das es wegen seiner Unklarheit dem Tribunal erlaubt, eigentlich alle geltende Rechtsvorschriften mit dem einfachen Argument zu disqualifizieren, dass sie entweder zu starr oder zu unbestimmt sind und dementsprechend den Richtern zu wenig oder zu viel Ermessensspielraum geben. Die Praxis zeigt dabei, dass meistens die Rechtsakte der Regierung den Sorgfaltskriterien nicht genügen, während die Rechtsakte der Opposition ihnen genügen. Eine bewundernswerte Konvergenz! Nehmen wir als weiteres Beispiel die Konstruktion der legislativen Unterlassung, die es dem Tribunal erlaubt, jede Vorschrift zu ignorieren, die die Arbeit des Tribunals behindert oder erschwert. In der Konsequenz kann das Tribunal die Rechtsvorschriften über das Quorum, die erforderliche Mehrheit oder die Reihenfolge der Beschlussfassung ignorieren. Das ist beispiellos in der Geschichte der modernen Justiz und bedeutet in der Tat, dass das Tribunal nach dem Prinzip „Anything goes“ funktioniert. Ich bin sehr gespannt, ob die deutschen Gerichte eine solche Situation tolerieren würden. In engem Zusammenhang mit der Konstruktion der legislativen Unterlassung steht bekannte Lähmungsargument, die das Tribunal - gemeinsam mit der Venedig-Kommission - ständig wiederholt.
Das Lähmungsargument ist ebenfalls falsch. Das Tribunal entscheidet jährlich ungefähr 500 Fälle (das ist eine stabile Tendenz). Etwa ¾ dieser Fälle beziehen sich auf Verfassungsbeschwerden, die der sogenannten Vorprüfung unterliegen. Sie erfolgt durch einen Richter (früher durch einen Beamten des Tribunals). Die Vorprüfung beruht auf der Feststellung, ob der Antrag rein formal die Bedingungen (Termine, Kosten, Anwaltszwang usw.) erfüllt. Auf jeden Fall ist das keine zeitraubende Tätigkeit. Wenn wir diesen Umstand in Betracht ziehen, dann erweist sich, dass die 15 Verfassungsrichter in Polen jährlich in der Sache ungefähr 100 Fälle entscheiden. Zum Vergleich: Ein ordentlicher Richter entscheidet auch rund 100 Fälle, aber monatlich! Das Lähmungsargument ist also offenkundig völlig unbegründet. Nebenbei möchte ich bemerken, dass in der vorherigen Legislaturperiode die Regierung der „Bürgerplattform“ über 60 Entscheidungen des Tribunals nicht implementierte und damals niemand von dramatischen Protesten des Tribunals und seiner Anhänger gehört hat. Es ist also nicht eine Frage der Sorge um die Rechtsstaatlichkeit , sondern eine Frage der Heuchelei derer, die die Macht verloren haben.
Dazu noch eine Bemerkung. Das Tribunal bezieht sich obsessiv auf den aus der Präambel der Verfassung abgeleiteten Grundsatz des ordnungsgemäßen und wirksamen Handelns öffentlicher Institutionen. Abgesehen von der Tatsache, dass nach herrschender Meinung aus der Präambel nur Auslegungsleitlinien und keine geltenden Rechtsnormen abgeleitet werden können, sollten wir darauf hinweisen, dass die Präambel in diesem Kontext eine Konjunktion verwendet, so dass öffentliche Institutionen gemeinsam zwei Bedingungen: Integrität (Fairness) und Effizienz erfüllen müssen. Die Argumentation des Tribunals ist also contra legem, weil unsere Verfassung keinen separaten Grundsatz der Effizienz der öffentlichen Institutionen kennt und gerade dieses Prinzip es dem Tribunal ermöglicht, sämtliche Entwürfe des Sejm und der Regierung als verfassungswidrig für nichtig zu erklären. Es sollte klar sein, dass Integrität (Fairness) sehr oft das Gerichtsverfahren erschwert und verlängert. Von einer Lähmung des Tribunals zu sprechen, scheint hier völlig unberechtigt zu sein.
Am Rande noch eine wichtige Bemerkung: Prof. Andrzej Rzepliński ist seit 10 Jahren (er hat das selbst eingeräumt) mit vielen Mitgliedern der Venedig-Kommission, insbesondere mit dem Präsidenten der Kommission Gianni Buquicchio, befreundet. Es stellt sich daher die Frage, warum diese Institution, die aus über 100 Mitgliedern besteht, nach Warschau einen „Bekannten” von Präsident A. Rzepliński entsendet. Das verstößt gegen Art.2 des Statuts der Venedig-Kommission (Unparteilichkeit der Kommission) und gegen die internationalen Standards für Forschungsexpertisen (Interessenkonflikt – The European Code of Conduct for Research Integrity 2002). Es sollte uns also nicht überraschen, dass die Berichte der Venedig-Kommission in jedem Punkt mit den Meinungen von A. Rzepliński übereinstimmen. Aus diesem Grund verstehe ich, warum die polnischen Behörden die Berichte und Empfehlungen der Venedig-Kommission nicht ernst nehmen.
Wie gesagt, nimmt die rechtsetzende Tätigkeit des Tribunals meistens die Form einer kreativen Auslegung der Verfassung und anderer Rechtsakte an. Dazu ist ebenfalls ein kurzer Kommentar notwendig. Die Verfassung von 1997 hat nach langen Diskussionen die allgemeinverbindliche Auslegung von Gesetzen abgeschafft. Die verfassungsgebende Versammlung erklärte – ob zu Recht oder zu Unrecht -, dass die allgemeinverbindliche Auslegung von Gesetzen gegen die Unabhängigkeit der Gerichte verstößt. Wenn das so ist, ist das Tribunal nicht berechtigt, im Tenor einer Entscheidung Auslegungsbestimmungen niederzulegen. Das darf es nur in der Urteilsbegründung tun. Dann aber sind die Auslegungsbestimmungen des Tribunals nicht imperio rationis, sondern nur ratione imperii verbindlich. Das Verfassungsgericht ignoriert die Entscheidung der verfassunggebenden Versammlung und setzt ständig unter Berufung auf den Inhalt von Art. 190 Abs. 1 im Tenor seiner Entscheidungen interpretative Richtlinien. Zunächst versuchte der Oberste Gerichtshof zu protestieren, aber ohne Erfolg (z.B. in der Entscheidung vom 6.5.2006). Diese Praxis ist evident contra legem, und die Regierung ist zu Recht mit dem Verfahren des Tribunals nicht einverstanden.
Lassen Sie uns jetzt den Vorwurf betrachten, dass die polnische Regierung europäische und internationale Rechtsstaatlichkeitsstandards verletzt. Nach meiner Überzeugung interpretiert die Venedig-Kommission die Rechtsstaatlichkeitsstandards, die aus der Europäischen Menschenrechtskonvention und den EU-Verträgen folgen, evident falsch. Insbesondere gilt das für Art. 4.2. des EU-Vertrags, der die EU zur Respektierung der nationalen Identität und grundlegenden politischen und verfassungsmäßigen Strukturen des Mitgliedsstaates verpflichtet. In engem Zusammenhang mit Art. 4.2. steht die EU-Devise „In Vielfalt geeint“. Es ist eine Banalität, dass in Europa nicht nur liberale, sondern ganz verschiedene Verfassungstraditionen existieren. Es ist ebenfalls eine Banalität, dass sich der polnische Konstitutionalismus nicht aus der liberalen, sondern aus der republikanischen Tradition ableitet. Auf der republikanischen Tradition beruhen alle polnischen Verfassungen, angefangen von der berühmten Verfassung vom 3. Mai 1791, die auf das Modell der amerikanischen Verfassung von 1787 und die französische Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte gegründet war, bis zu heutigen Verfassung von 1997. Dieser Tradition ist die überwiegende Mehrheit unserer Bürger treu. Aus diesem Grund stimmte die Mehrheit der Polen in den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen für die Vertreter der Partei „Recht und Gerechtigkeit“, und die Partei erlangte einen enormen Vorsprung, wie er in der Geschichte der polnischen Wahlen unbekannt war.
Die republikanische Tradition stützt sich nicht nur auf die Verteidigung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit, sie ist auch anderen Werten treu, wie dem Gemeinwohl, der gesellschaftlichen Solidarität, dem Patriotismus, der Verbundenheit mit der katholischen Religion und Kirche, der Treue zum traditionellen Modell von Ehe und Familie oder dem Widerstand gegen die Abtreibung. Die republikanische Tradition ist nicht nur in Ländern wie Polen und Ungarn lebendig, sie hat auch viele Anhänger in den USA, England oder Frankreich. Die Venedig-Kommission verhält sich so, als ob sie davon nichts wüsste. Die Venedig-Kommission scheint auch nicht zu wissen, dass die größten Philosophen des Liberalismus, mit John Rawls und Jürgen Habermas an der Spitze, zu einer republikanischen Korrektur der liberalen Institutionen aufrufen. Mit Bezug auf Habermas muss ich sagen, dass das, was in Polen jetzt geschieht, leider ein Versuch der wirtschaftlichen und rechtlichen Kolonisierung Polens (und anderer mitteleuropäischer Länder) durch die westlichen Staaten ist.
Glauben Sie nicht an einen Zerfall der Demokratie in Polen. Sie können doch nach Warschau fahren und nach Belieben gegen alles protestieren. Sie werden daran nicht gehindert, weil in Polen Diskutieren und Protestieren zum demokratischen Kanon gehört. Lassen Sie diesen Unsinn beiseite, den die Opposition erfunden hat, um Sie um Hilfe zu bitten und auf diese Weise ohne demokratische Abstimmung wieder an die Macht zu kommen. Lassen Sie uns unser eigenes Leben in Einklang mit unseren Traditionen leben. In Polen wird niemand verfolgt. Toleranz gehört in Polen seit Jahrhunderten zu den wichtigsten Elementen des republikanischen Ethos. Auf keinen Fall wird die polnische Regierung es zulassen, dass ein Grüppchen politischer Verlierer darüber entscheiden wird, wie die überwiegende Mehrheit der Bürger meines Landes leben sollte. Und noch ein Wort: Wir wollen in der EU sein, aber nicht in einer EU, die nationale Identitäten geringschätzt. Und um Gottes willen nicht in einem Europa, das von orthodoxen Liberalen und linken Doktrinären dominiert wird. Sie töten die EU, nicht uns.
Prof. Lech Morawski
Geb. 1949 in Bydgoszcz/Bromberg. 1972 absolvierte er ein Jura-Studium an der Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń/Thorn. Seit 1999 Professor der Rechtswissenschaften. Beruflich ist er mit der Nikolaus-Kopernikus-Universität verbunden. Seit 1998 leitet er den Lehrstuhl für Rechts- und Staatstheorie. Er leitete außerdem den Lehrstuhl für die Theorie und Philosophie des Rechts an der Kardinal-Stefan-Wyszyński-Universität in Warschau. 1989-1990 und 1990 Humboldt-Stipendiat. Mitglied in verschiedenen polnischen und internationalen Gesellschaften, u. a. der International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy. Mitglied des Wissenschaftlichen Komitees der 2. und der 3. Smoleńsk-Konferenz 2013-2014, die den Absturz der TU-154 in Smoleńsk am 10.04.2010 untersuchte. Im Dezember 2015 wurde er als Kandidat der Partei „Recht und Gerechtigkeit“ zum Mitglied des Verfassungsgerichts gewählt.
Ausgewählte Publikationen:
- Die Grundprobleme der zeitgenössischen Philosophie des Rechts: das Gesetz im Wandel (1999)
- Die Auslegung in der Rechtsprechung der Gerichte (2002)
- Die Auslegung des Rechts und andere Herausforderungen der Philosophie des Rechts (2005)
- Grundlagen der Philosophie des Rechts (2014)